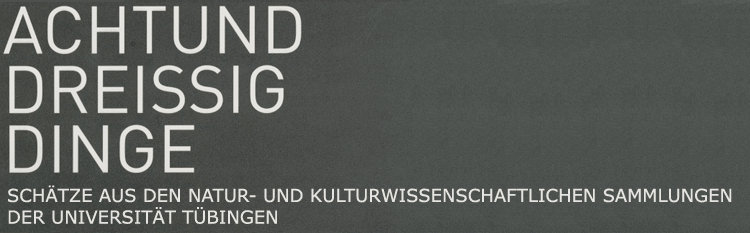
Nr. 05/38
Selbstbildnis mit gerunzelter Stirn

Rembrandt Harmensz. van Rijn; um 1630; Radierung (II. Zustand); 6,7 x 5,6 cm;
Vermächtnis des Tübinger Kreisgerichtsrates Freiherr Otto von Breitschwert, 1910;
Graphische Sammlung am Kunsthistorischen Institut, Universität Tübingen
(Foto: Eva Parth)
Rembrandt – Selbst
Im malerischen und druckgraphischen Werk Rembrandts finden sich zahlreiche Selbstbildnisse des holländischen Künstlers. Das kleinformatige Blatt entstand in der Frühzeit um 1630, zu Beginn der Amsterdamer Schaffenszeit. In dieser Phase fertigte Rembrandt mehrere Druckgraphiken, die Zeugnis geben von einem intensiven Studium der Physiognomie und der Affekte. Frontal, mit entschlossenem, fast grimmigen Ausdruck zeigt sich der Künstler dem Betrachter im Brustporträt vor knappem, neutralem Grund. Die Physiognomie ist durch fein modellierte Bewegungen mit gerunzelter Stirn und zusammengezogenen Brauen charakterisiert. Der auf einen Punkt ausgerichtete feste Blick kontrastiert das fast schulterlange, offene lockige Haar. Zusätzlich verdichtet die stark schattierte Gesichtshälfte den Ausdruck, der durch die fein bewegte Strichführung der Radiertechnik erzeugt wird. In der zeitgenössischen Kunsttheorie galt zugleich die Wiedergabe komödiantenhafter Grimassen als besondere künstlerische Qualität des „poetischen Geistes“ des Malers (Raupp 1984).
Das Selbstbildnis ist in vier Druckzuständen bekannt, wobei das Tübinger Exemplar den zweiten Zustand dokumentiert, nachdem Rembrandt die Druckplatte verkleinert hatte. Das mehrfache Überarbeiten der Platten ist typisch für die direkte Arbeitsweise des Künstlers. Vorzeichnungen zur Radierung sind nicht bekannt.
Rembrandt war bereits bei seinen Zeitgenossen berühmt
für die malerische Anwendung der Radierung
und ihrer graphischen Auslotung des Hell-Dunkel,
für die es in der Druckgraphik keine Vorbilder gab.
Über den Vertrieb und die Auflagenhöhe der Blätter
ist fast nichts überliefert.
Seine Druckgraphiken waren bereits
bei seinem Tod in allen wichtigen europäischen Sammlungen
vertreten.
Das Tübinger Exemplar gelangte über die testamentarische
Stiftung des Kreisgerichtsrates Freiherr
Otto von Breitschwert (1829-1910) in die Graphiksammlung
des Kunsthistorischen Instituts. Aus
Quellen wissen wir, dass dieser Sammler das Blatt –
mit weiteren Werken des Künstlers – im Jahre 1894
bei dem Stuttgarter Kunsthändler Schlesinger erworben
hat. Auf der Rückseite der Radierung findet sich
die Wertschätzung eines Vorbesitzers des Blattes,
der dieses handschriftlich als „sehr selten“ – „très
rare“ bezeichnet. Künstlerbildnisse stellen einen
Schwerpunkt im Bestand der Graphischen Sammlung
des Kunsthistorischen Instituts dar. Dieser Bereich
wurde in den letzten Jahren bis in die Klassische
Moderne ausgebaut (Sammlung Rieth) und ergänzt
die praxisorientierte Ausbildung von Studierenden
der Kunstgeschichte auf ideale Weise. Im Studiensaal
der Graphischen Sammlung können darüber
hinaus Interessierten anhand der Vorlage von Originalen,
zu regelmäßigen Öffnungszeiten, Einblicke in
die Sammlung gewährt werden.
Anette Michels
- Bevers, H. / Schatborn, P. / Welzel, B. (1991): Rembrandt.
Der Meister und seine Werkstatt. Zeichnungen und Radierungen.
Ausstellungskatalog Berlin / Amsterdam / London. München :
Kat. Nr. 2.
- Raupp, H.-J. (1984): Untersuchungen zu Künstlerbildnis und
Künstlerdarstellung in den Niederlanden im 17. Jahrhundert.
Hildesheim / Zürich / New York : 175-81.
- Universitätsarchiv Tübingen, UAT 175/6 [testamentarische Stiftung
des Kreisgerichtsrates Freiherr Otto von Breitschwert].
- White, C. (1969): Rembrandt as an etcher. Vol. 2. London : 108.
- White, C. / Boon, K. G. (1969): Hollstein‘s Dutch and Flemish
Etchings, Engravings and Woodcuts 1450-1700. Vol. XVIII. Amsterdam
: B 10/II.
Impressum | © Copyright Universität Tübingen | Stand 12.06.2006